Heft 76 ( 38. Jg. 2025): Georg Groddeck
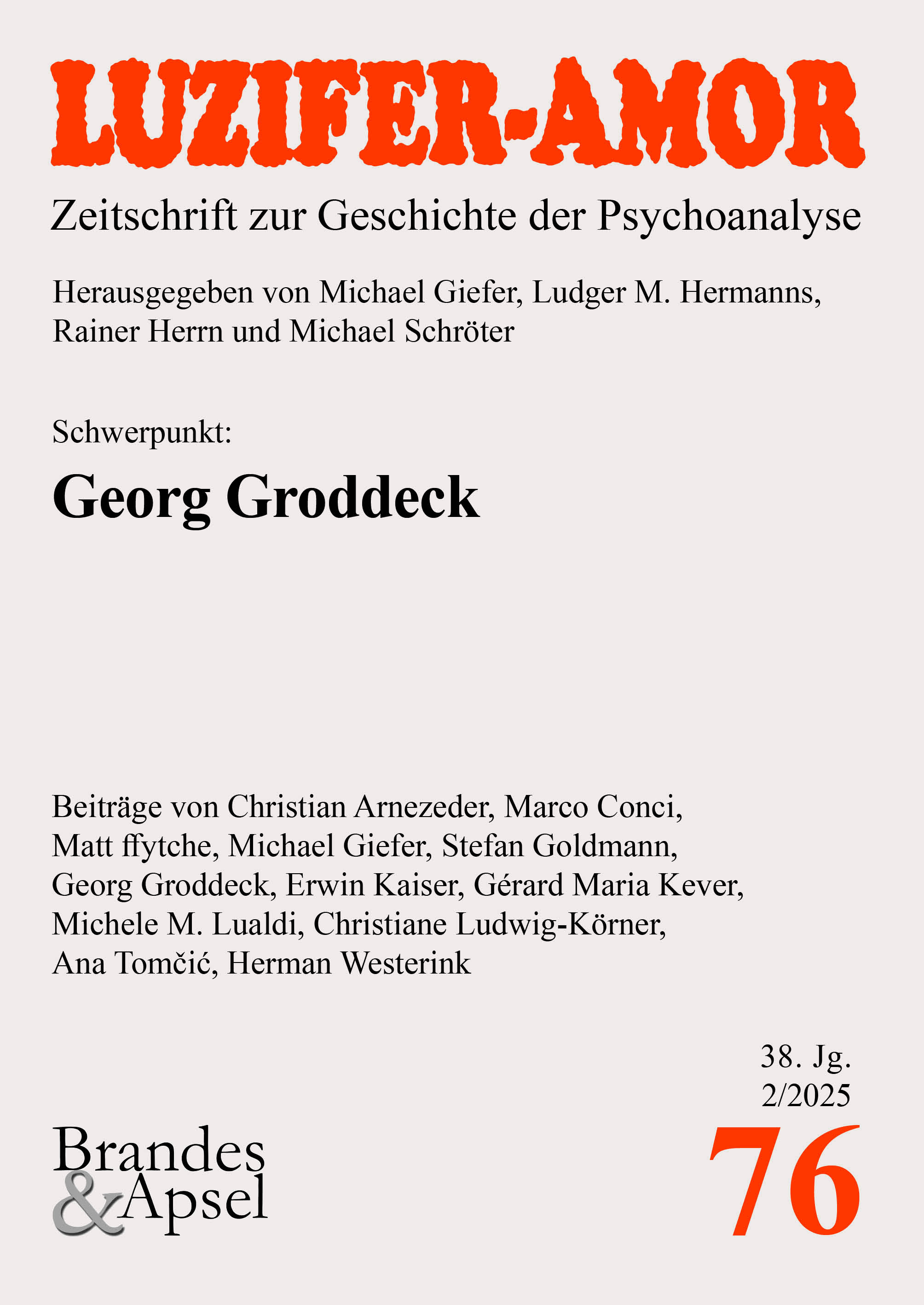
bestellen (Heft oder E-Journal) (Gesamtheft und Einzelbeiträge)
Editorial (S. 5–6)
Der verantwortliche Herausgeber dieses Heftes von LUZIFER-AMOR hat zunächst die traurige Pflicht, den Tod von Thomas Aichhorn anzuzeigen. Thomas Aichhorn war dieser Zeitschrift über mehrere Jahrzehnte als Autor, wissenschaftlicher Beirat und Herausgeber einiger Hefte eng verbunden. Er ist vielen Lesern vertraut gewesen. Michael Schröter würdigt seine Person und sein Wirken zu Beginn dieser Ausgabe.
Der Schwerpunkt dieses Hefts ist Georg Groddeck gewidmet, dem Außenseiter in der psychoanalytischen Bewegung der 20er- und 30er-Jahre, dem Schöpfer des Es-Begriffs und dem Pionier der psychoanalytischen Psychosomatik. Bekannt ist Groddeck als der »wilde« Analytiker, Verfasser des psychoanalytischen Romans Der Seelensucher und des Buchs vom Es. Nach seinem Tod 1934 wurde er rasch vergessen und erst in den 1970er-Jahren wiederentdeckt. Allerdings blieb das Interesse an ihm auf einen kleinen Kreis beschränkt. Die rund 20-bändige Werkausgabe – herausgegeben von der Georg Groddeck-Gesellschaft – wurde kaum rezipiert. Dies mag daran liegen, dass er sich weigerte, seine Entdeckungen in die psychoanalytische Metatheorie einzupassen und weitgehend die analytische Nomenklatur zu meiden. Dennoch war er für eine Reihe von Psychoanalytikern, angefangen bei Freud und Ferenczi, anregend gewesen.
In seinem Aufsatz »›… ein Gegenstand liebender Wut u. wütender Liebe!‹ – Sechzehn Briefe zu Groddecks 60. Geburtstag«, die hier abgedruckt sind, dokumentiert Michael Giefer diese Ambivalenz, die Groddeck in der psychoanalytischen Organisation auslöste. Karl Landauer, Heinrich Meng und Lou Andreas-Salomé gehörten u. a. zu den Gratulanten. Einen Eindruck von Groddecks Persönlichkeit und Eigenwilligkeit vermittelt sein Beschwerdeschreiben als Lazarettarzt an die kgl. Kommission von 1915, das von Michael Giefer eingeleitet wird. Mit der Anekdote vom »wilden« Analytiker, die mit Groddecks erstem Auftritt an einem Internationalen Psychoanalytischen Kongress verbunden ist, beschäftigt sich Michele Lualdi in seinem Artikel »Georg Groddeck auf dem VI. Internationalen Kongress in Den Haag (1920)«. Dank seiner Forschung kann man sehen, dass die Biografen nicht immer genau arbeiten. Zudem klärt er den Hintergrund des Begriffs wild anhand des Briefwechsels Groddeck/Freud auf. In seinem Beitrag »Auf der Suche nach der Seele: Kulturentstehung zwischen Triebverzicht und Triebglück« befasst sich Gérard Kever mit Freuds und Groddecks Verhältnis zum Bildnis der »Sixtinischen Madonna« von Raffael. Er fragt danach, weshalb dies sexuelle Vexierbild in der Psychoanalyse bisher so wenig Beachtung fand.
Die Rubrik »Aus der Forschung« wird mit einer Arbeit von Hermann Westerink »Die traumatische Neurose und die biologischen Spekulationen in der Erst- und Zweitfassung von Freuds Jenseits des Lustprinzips eröffnet. Er vertritt die These, dass der Todestrieb in der zweiten Fassung eingeführt wurde, um inakzeptable Implikationen der ersten Fassung zu korrigieren. Freud positioniert sich in der zweiten Fassung zu den Lebensdebatten in jener Zeit. In seinem Beitrag »Freud war anders. Ansätze zu einer Philologie des Zitats« untersucht Stefan Goldmann die Verwendung verschiedener Zitate in Freuds Schriften und Briefen. Freud steht damit in der Tradition der deutschen Wissenschaftsprosa des 19. Jahrhunderts. Mit der Benutzung von Zitaten in der Kommunikation befasst sich auch Michele Lualdi in seinem Aufsatz. Mit einem anderen Aspekt von Freuds Sprache beschäftigt sich Erwin Kaiser in seinem Artikel »Erkenntnistheoretische Aspekte von Freuds Sprachauffassung«. Ausgehend von dessen Aphasie-Arbeit versucht er, die Grundlage von Freuds Sprachauffassung zu verstehen, und unterscheidet drei Kategorien: eine physiologische, eine psychologische und eine klinische. Er kommt zu dem Schluss, dass Freud eine der Physiologie entlehnte Metapher benutze. Stefan Goldmanns zweiter Beitrag in diesem Heft »Reinhold Stahl (1904–1944). Kunstschriftsteller und Antiquar« ist ein Lebensporträt des Mannes, der Freuds Briefe an Wilhelm Fliess an Marie Bonaparte verkauft hat. Im Anhang werden die frühesten Freud-Autographen, die in den Antiquariatshandel gelangt sind, aufgeführt und gewürdigt. Dem schließt sich die umfangreiche Arbeit des Walisers Matt ffytche »Widerstand, Panzerung, Rückzug: der psychoanalytische Krieg gegen den Charakter« an. ffytche befasst sich hauptsächlich mit Wilhelm Reichs Charakteranalyse. Mit der Hinwendung zur Ich-Psychologie in den 1920er- bis 1950er-Jahren geht auch eine Abkehr von der Symptomanalyse hin zu einer Strukturanalyse des Patienten einher, was mit einer neuen Technik verbunden ist, die der Autor als »Krieg« gegen den Charakter bezeichnet. Daraus ergeben sich eine neue Einstellung des Analytikers und der neue Typ des »narzisstischen Charakters«. Der Autor kommt dann auf die Frage zurück, was es bedeutet, sich mit einer Demontage des Charakters zu befassen, ohne sich mit der Charaktertheorie anderer Disziplinen zu beschäftigen. Ana Tomcic befasst sich in ihrer Arbeit »Trauma, Gemeinschaft und Gesellschaft in der Psychoanalytischen Pädagogik von Nelly Wolffheim « vor allem mit der Thematik der Gemeinschaftserziehung und vergleicht Wolffheims Ansätze mit denen anderer Kinderanalytikerinnen. Die Rubrik »Aus der Forschung« wird mit einer Arbeit von Christian Arnezeder »Marie Jahoda und ihr Beitrag zur Psychoanalyse « abgeschlossen. Die österreichische Sozialpsychologin Jahoda – bekannt als Mitverfasserin der Untersuchung Die Arbeitslosen von Marienthal – hatte bei Heinz Hartmann eine Analyse gemacht und sich zeitlebens mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt. Sie hat verschiedene Arbeiten darüber verfasst, wie die Psychoanalyse die »Unzulänglichkeiten der akademischen Psychologie« zu beheben helfen könnte.
Die Rubrik »Kleine Mitteilungen« enthält einen Bericht von Christiane Ludwig-Körner über die Vernissage an der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin. In der dortigen Bibliothek wurde eine erste Vitrine gestaltet von der Initiativgruppe für ein Freud-Museum Berlin enthüllt, die vor allem Exponate aus dem Simmelschen Sanatorium »Schloss Tegel« enthält. Inzwischen ist in diesem Frühjahr eine zweite Vitrine aufgestellt worden. Es folgt dann der Bericht von Marco Conci über das 38. Symposion zur Geschichte der Psychoanalyse. Abgerundet wird das Heft wie immer mit Rezensionen und Mitteilungen zu weiteren Neuerscheinungen von Büchern zur Geschichte der Psychoanalyse.
Michael Giefer
